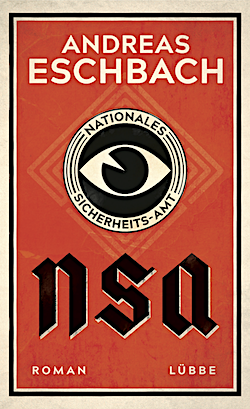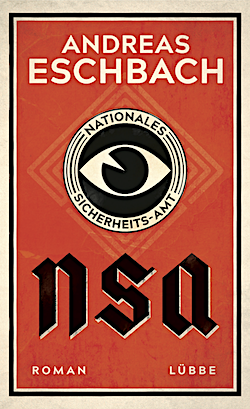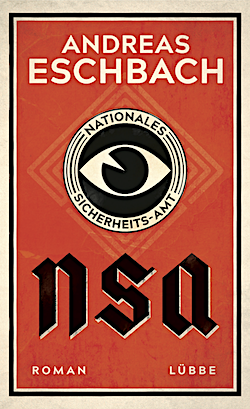
Nationales Sicherheits-Amt
Roman
von
Andreas Eschbach
Zurück zu Teil 2
Helene saß wie gelähmt vor ihrer Tastatur. Das hatte sie alles nicht gewusst. Sie hatte die Programme geschrieben, nach Vorgaben, die sie von Herrn Adamek, von Herrn Lettke und von Herrn Dobrischowsky erhalten hatte, genau wie sonst auch. Und wie sonst auch hatte sie nicht gefragt, wozu die Auswertungen dienen sollten; derlei Fragen standen Programmstrickerinnen nicht zu.
Natürlich hatte sie sich ihre Gedanken gemacht. Aber es war schließlich nur um Lebensmittel gegangen, um Kalorienzahlen – was hätte sie da anderes vermuten sollen, als dass es um die Ernährungssituation des Volkes ging? Darum, die Versorgungslage zu untersuchen, herauszufinden, wo die Menschen genug zu essen hatten und wo nicht?
Aber das jetzt … Ihre Hände fühlten sich tonnenschwer an. In ihrem Bauch zitterte etwas ganz elendiglich. Ihr war danach, hinauszurennen und sich auf der Toilette zu verstecken, aber die Völkers würde ihr nachher den Kopf abreißen, wenn sie das wagte.
Vielleicht würde sie es schaffen, sich nicht zu übergeben.
Der Diskussion, die unter den Männern entbrannt war, folgte sie nur mit halbem Ohr. Wurde denn in Amsterdam schon bargeldlos bezahlt? Ja, lautete die Antwort, mehr oder weniger seit der Besetzung der Niederlande. Man hatte den Gulden abgeschafft, alles Bargeld eingezogen und die bargeldlose Reichsmark eingeführt, genau wie in Deutschland. Und standen denn auch alle benötigten Tabellen zur Verfügung?
»Fräulein Bodenkamp?« Die Stimme Adameks. »Helene?«
»Ja?« Sie schreckte hoch.
»Haben wir, Amsterdam betreffend, alle benötigten Tabellen?«
»Ja.« Da standen sie aufgelistet, vor ihr auf dem Schirm. Ihre Hände mussten das getan haben, ohne dass sie es mitbekommen hatte.
»Dann starten Sie die Auswertungen, bitte.«
»Ja«, hörte sich Helene Bodenkamp sagen, gehorsam, wie es einer deutschen Frau geziemte, und dann sah sie ihren Händen zu, wie sie die notwendigen Befehle eintippten.
Und schließlich die Ausführen-Taste drückten.
Warum musste sie gerade an Ruth denken, die Freundin aus Kindertagen? Ruth Melzer, die sich eines Tages im Klassenzimmer ganz nach hinten hatte setzen müssen und den deutschen Gruß nicht hatte machen dürfen, mit dem alle anderen den Lehrer empfingen. Ruth Melzer, die kurz darauf mit ihren Eltern nach Amerika gegangen war, für immer, und von der sie nie wieder etwas gehört hatte.
Während die Auswertung lief und die Prozentzahl auf dem Schirm langsam wuchs – ihr war, als könne sie hören, wie die Silos unten in den Hallen jetzt gerade ratterten und klackerten und wie die Lüfter der Komputer ansprangen, weil die Recheneinheit auf Hochtouren lief –, während also all das Unheimliche, Schreckliche seinen unaufhaltsamen Gang nahm, erläuterte Himmler, wieso ausgerechnet Amsterdam.
»Als die Wehrmacht die Niederlande eingenommen hatte und wir uns die Unterlagen ansehen konnten, haben wir festgestellt, dass die Stadtverwaltung von Amsterdam schon seit langem ein Verzeichnis führt, welcher Religion die in der Stadt wohnhaften Bürger angehören. Das Ganze hatte steuerliche Gründe, aber für uns war es natürlich ein Geschenk der Vorsehung. Anders als im Altreich, wo das Amt für Rassenkunde aufwendige genealogische Untersuchungen anstellen muss, um zu ermitteln, wer Jude ist, hatten wir, was Amsterdam betraf, auf einen Schlag eine komplette Liste zur Hand. Was die notwendigen Maßnahmen natürlich enorm vereinfacht hat.«
»Ja, das war ein echter Glücksfall«, pflichtete ihm Adamek bei.
»Wir haben im Frühsommer mit den Deportationen begonnen«, fuhr Himmler fort, »aber da wir diese Liste haben, wissen wir, dass wir nicht alle Juden erwischt haben. Von manchen heißt es, sie seien ins Ausland gegangen, aber bei einem Abgleich mit den Aufzeichnungen der Grenzbehörden stellten wir fest, dass das nicht stimmen kann. Das heißt, wenn sie nicht gerade über die Nordsee davongeschwommen sind, dann sind sie noch da, irgendwo in der Stadt untergetaucht in der Hoffnung, dass wir eines Tages wieder verschwinden.« Er ballte die Faust, eine Geste jäh aufflammender Wut. »Aber wir verschwinden nicht wieder. Wir sind gekommen, um tausend Jahre zu bleiben.«
Atemlose Stille herrschte nach diesem unvermittelten Ausbruch des Reichsführers. Niemand rührte sich, niemand sagte etwas. Alle starrten nur auf die Prozentzahl auf der Leinwand, die sich langsam der 100 näherte.
Dann verschwand sie, und eine Liste erschien.
Die ersten zwei Zeilen lauteten:
Gies – 6.710 Kalorien pro Tag und Person
van Wijk – 5.870 Kalorien pro Tag und Person
»Treffer«, sagte Lettke in die Stille hinein.
Himmler stand auf. »Was heißt das?«
»Diese Leute kaufen das fast Dreifache dessen an Lebensmitteln, was sie selber verzehren können«, erklärte Adamek. »Fräulein Bodenkamp, bitte die Einträge aus der Haushaltstabelle.«
Helene war es, als habe sich ein ungeheures, unsichtbares Gewicht auf sie gelegt, so schwer, dass sie kaum atmen konnte. Doch ihre Hände, diese Verräterinnen, arbeiteten weiter, tippten die notwendigen Befehle mit unverminderter Flinkheit ein, und die Anzeige auf der Leinwand erweiterte sich um Informationen über die Personen, die sich hinter diesen Familiennamen verbargen.
Die erste Zeile bezog sich auf ein kinderloses Ehepaar, Jan Gies und Miep Gies-Santrouschitz. Geburtsdaten, Geburtsorte – die Ehefrau kam aus Österreich –, Wohnort, Arbeitsstelle.
Hinter der zweiten Zeile verbarg sich ebenfalls ein Ehepaar, Cor van Wijk und Elisabeth van Wijk-Voskuijl. Ebenfalls keine Kinder.
»Vier Personen, die insgesamt auf einen Tagesschnitt von über 25.000 Kalorien kommen«, fasste Adamek zusammen, dessen Fähigkeit zum Kopfrechnen legendär war. »Das entspricht dem Nahrungsbedarf von zehn Personen oder mehr.«
»Die beiden Frauen arbeiten in derselben Firma«, stellte Dobrischowsky fest.
»Was ist das für eine Firma?«, fragte Adamek, an Helene gewandt.
Wieder tanzten die Finger. Die Firma hieß OPEKTA, hatte ihren Sitz in der Prinsengracht 263, betrieb Handel mit Gewürzen und gehörte einem Johannes Kleiman und einem Victor Kugler.
»Sie hat erst im Dezember 41 den Besitzer gewechselt, also nach der Besetzung«, warf Lettke ein. »Das könnte auf ein Tarngeschäft hindeuten. Wer war der Vorbesitzer?«
Helenes Hände riefen die entsprechenden Daten auf.
»Otto Frank.« Dobrischowsky schüttelte den Kopf. »Ist das ein holländischer Name?«
Weiter, weiter, weiter. Ihre Hände tanzten über die Tasten, entrissen den Silos immer weitere Daten. Otto Frank, verrieten sie, war in der Tat kein Holländer, sondern ein deutscher Jude, der im Februar 1934 in die Niederlande ausgewandert war.
»Typisch Jude«, meinte Himmler. »Kommt als Niemand in ein fremdes Land, und ein paar Jahre später ist er reich und lässt Einheimische für sich arbeiten.«
Otto Frank, verrieten die Daten weiter, hatte mit seiner Familie im Merwedeplein 37 gelebt, war dort aber zuletzt am 5. Juli 1942 gesehen worden. Im Bericht des Deportationskommandos war vermerkt, die Familie sei Gerüchten zufolge in die Schweiz geflüchtet.
»Oder auch nicht«, meinte Himmler und zog sein Telephon aus der Tasche.
Helene zuckte unwillkürlich zusammen, als sie diese Bewegung sah. Etwas Unerhörtes haftete ihr an, war es doch strengstens verboten, tragbare Telephone mit in die Amtsräume zu nehmen.
Aber natürlich wäre es niemandem eingefallen, dem Reichsführer SS zuzumuten, sein Telephon am Eingang zu deponieren, wie es für sie alle Pflicht war.
»Schulz?«, rief Himmler schnarrend. »Wir haben hier gerade Hinweise auf versteckte Juden in Amsterdam gefunden. Schicken Sie ein Suchkommando in die Prinsengracht 263 und lassen Sie das Anwesen von oben bis unten durchsuchen. Ja, 263. Außerdem Suchkommandos an folgende Adressen – schreiben Sie mit.« Er las dem Mann in Amsterdam die Adressen der Ehepaare Gies und van Wijk vor sowie die Adressen von Johannes Kleiman und Victor Kugler. »Ausführung sofort, so schnell wie möglich. Und erstatten Sie mir unverzüglich Bericht.«
Er nahm sein Telephon vom Ohr und sagte: »Jetzt heißt es warten.«
Sein Telephon, bemerkte Helene, schimmerte golden und ließ sich zusammenklappen, war also definitiv kein Volkstelephon. Vermutlich handelte es sich um eines der Luxusmodelle, die Siemens kurz vor Ausbruch des Krieges auf den Markt gebracht hatte.
Und so warteten sie. Saßen da, starrten ins Leere, ließen die Zeit verstreichen. Kirst zündete sich eine seiner unvermeidlichen Overstolz an. Adamek kaute auf dem Knöchel seines rechten Daumens herum. Lettke zwirbelte die Enden seines albernen Oberlippenbärtchens. Himmler zog sich mit seinem Adjutanten in den Hintergrund des Saals zurück und erteilte ihm leise ein paar Anweisungen; dann, während der maschinenhaft wirkende SS-Mann aus dem Saal schlüpfte, kehrte er zu seinem Stuhl zurück und ließ sich geräuschvoll wieder hineinfallen.
Endlich, nach hundert Jahren, wie es Helene vorkam, klingelte das Telephon des Reichsführers wieder. »Ja?«, bellte er ungeduldig, lauschte. Dann sagte er: »Fehlanzeige an der Adresse van Wijk.«
»Wie erklären sie ihre Lebensmittelkäufe?«, fragte Adamek.
Himmler starrte ihn finster an. »Haben Sie nicht aufgepasst? Davon habe ich meinen Leuten nichts gesagt, also, warum hätten sie danach fragen sollen?«
»Sie haben recht«, gab Adamek sofort zu. »Bitte entschuldigen Sie, Reichsführer.«
»Falls das hier funktioniert«, sagte Himmler, »werde ich den Teufel tun und irgendjemandem verraten, wie wir Untergetauchte finden.«
Adamek nickte. »Das ist zweifellos ratsam.«
Himmler sah grimmigen Blicks ins Leere. »Dass es überhaupt möglich ist, dass jemand in einem besetzten Gebiet so viele Lebensmittel kaufen kann! Vielleicht sollten wir alles rationieren. Dann könnte niemand heimlich irgendwelche Juden durchfüttern, ohne selber zu verhungern …«
Sein Telephon klingelte wieder. Diesmal ging es um die Suche im Haus Kuglers, die ebenfalls nichts erbracht hatte.
So ging es weiter, eine Adresse nach der anderen. Zuallerletzt meldete sich das Suchkommando aus der Prinsengracht.
»Sie haben das Gebäude von oben bis unten durchsucht«, berichtete Himmler, das Telephon gegen die Brust gedrückt.
»Und?«, fragte Adamek.
»Nichts«, sagte der Reichsführer SS grimmig. »Sie haben nichts gefunden. Nicht das Geringste.«
Helene sah, wie die Männer alle die Augen aufrissen vor Entsetzen. Bestimmt bemerkte niemand, dass sie dagegen erleichtert aufatmete.
***
»Moment«, sagte Lettke in die erschrockene Stille hinein. Es überraschte ihn selber, wie klar und entschieden seine Stimme klang. »Einen Moment, bitte.«
Dann wandte er sich an die Strickerin und sagte: »Ich gehe davon aus, dass wir auch die Grundbuchdaten von Amsterdam haben?«
Das Mädchen nickte mit großen Augen. »Ja. Selbstverständlich.«
»Zeigen Sie uns den Grundriss des Gebäudes.«
Er sah Adamek anerkennend nicken, hörte, wie er »Gute Idee« sagte. Er sah, wie Dobrischowsky an seinem Hemdkragen zerrte, sah Kirst nervös die nächste Zigarette aus seinem silbernen Etui fingern, sah Möller den Kopf einziehen.
Und er sah Himmlers Blick, kalt wie Eis. Wenn das jetzt in die Hose ging, dann rettete ihn nichts mehr.
Der Grundriss des Gebäudes erschien auf der Leinwand. Es war mehrgeschossig und, typisch für die Stadt Amsterdam, die Gebäude einst nach ihrer Fassadenbreite besteuert hatte, sehr schmal, dafür aber tief.
»Kann ich direkt mit Ihrem Sturmbannführer sprechen?«, fragte Lettke, selber erstaunt über seine Kühnheit.
Himmler wog sein Telephon unentschlossen in der Hand, schien nicht sonderlich geneigt.
»Ich kann es an die Lautsprecheranlage anschließen«, bot Dobrischowsky an. »Dann können wir alle mithören. Ist nur ein Handgriff.«
»Also gut«, sagte Himmler.
Dobrischowksy zog ein klobiges Kabel hervor und stöpselte es in den Verstärker ein. Während der alte Kasten knisternd in Gang kam, verband er das andere Ende mit dem Telephon des Reichsführers. »Können Sie uns hören, Sturmbannführer?«, rief er dann.
»Laut und deutlich«, kam es aus den in der Täfelung verborgenen Lautsprechern.
»Eugen Lettke hier«, rief Lettke. »Sturmbannführer, bitte beschreiben Sie uns die Räumlichkeiten, die Sie in der Prinsengracht 263 vorgefunden haben.«
Der Mann am anderen Ende der Verbindung räusperte sich, dann beschrieb er den Aufbau des Hauses in genau der Reihenfolge, in der sie es durchsucht hatten. Alles, was er über das Erdgeschoss sagte, stimmte mit dem Grundriss überein.
Jetzt wurde Lettke auch heiß, und er unterdrückte nur mit Mühe den Impuls, ebenfalls den Kragen seines Hemdes zu lockern.
»Über die Treppe gelangen wir in den ersten Stock«, fuhr die schneidige Männerstimme fort. »Rechter Hand eine Tür, die in einen Lagerraum zur Straßenseite führt, schräg vor mir eine steile Treppe – fast eher eine Leiter – hinauf in den zweiten Stock, geradeaus ein schmaler Flur. Rechts eine weitere Tür in einen weiteren Lagerraum, am Ende des Flurs eine Tür, hinter der nur ein kleiner Raum liegt, der rechter Hand zwei Fenster in den Hof aufweist und offenbar als Bibliothek dient. Ich drehe um, um in den zweiten Stock –«
»Halt!« Lettke spürte sein Herz wie wild pochen. »Gehen Sie noch einmal zurück in den kleinen Raum. Was sehen Sie dort genau?«
»Ein großes Bücherregal. Dies und das. Eine Art Abstellraum.«
»Keine Tür, die weiter nach hinten führt?«
»Nein.«
Sie sahen es alle: Der Grundriss des ersten Stocks zeigte hinter dem kleinen Zimmer weitere Räumlichkeiten.
Es funktionierte. Unglaublich. Das Hochgefühl, das Lettke auf einmal durchströmte, nahm ihm fast den Atem.
»Sturmbannführer«, rief er, »beschreiben Sie, wo genau das Bücherregal steht.«
»An der Wand gegenüber der Tür.«
»Überprüfen Sie, ob es einen Zugang verbirgt.«
»Das haben wir schon. Es ist fest mit der Wand verschraubt.«
»Gehen Sie von der Annahme aus, dass es sich um ein Täuschungsmanöver handelt, und überprüfen Sie es noch einmal.«
»Hmm«, machte der SS-Mann. »Na gut.« Man hörte ihn ein paar Namen in den Hintergrund rufen und Befehle erteilen, dann wurde es still bis auf undefinierbare, weit entfernte Geräusche.
Endlich wurde das Telephon geräuschvoll wieder aufgenommen.
»Sie hatten recht«, sagte der SS-Mann mit hörbarer Verblüffung. »Das Regal ist schwenkbar, und die Verriegelung ziemlich gut versteckt. Und dahinter geht es tatsächlich weiter.«
Im Hintergrund war Geschrei zu hören.
»Es halten sich mehrere Personen dahinter auf«, berichtete der SS-Mann.
»Alle verhaften«, befahl Himmler mit schnarrender Stimme. »Personalien feststellen.«
»Zu Befehl, Reichsführer.«
Eine Weile hörte man herrisches Gebrüll, das Schluchzen von Frauen, das Weinen von Kindern, alles weit fort, fast nur zu erahnen. Dann meldete sich der Sturmbannführer wieder. »Wir haben in den verborgenen Räumlichkeiten insgesamt acht Personen vorgefunden, alles Juden. Nach vorläufigen Erkenntnissen handelt es sich um Otto Frank, seine Ehefrau Edith Frank und die beiden Kinder Margot und Anne Frank, ferner um Herman van Pels, seine Ehefrau Auguste van Pels und den Sohn Peter van Pels, sowie einen Fritz Pfeffer.«
Acht Juden. Lettke gestattete sich ein triumphierendes Lächeln. Damit sollten sie die Nützlichkeit des NSA zur Genüge unter Beweis gestellt haben. Und er hatte wesentlich dazu beigetragen! Wenn das seinen UK-Status nicht verlängerte, dann gab es nichts, was das vermochte.
»Bei einem der Mädchen«, fuhr der SS-Mann fort, »haben wir ein Tagebuch sichergestellt. Sollen wir es zwecks Auswertung weiterleiten?«
Himmler verzog angewidert das Gesicht. »Nein. Vernichten Sie es. Nicht, dass es auf irgendwelchen Wegen unseren Feinden in die Hände fällt und zur Propaganda gegen uns benutzt wird.«
»Zu Befehl, Reichsführer.« Man hörte, wie er nach hinten rief: »Schulze? Verbrennen Sie es. Ja, sofort.«
»Die gefassten Juden sind unverzüglich nach Auschwitz zu überstellen«, ordnete Himmler an. »Und alle, die an dem Komplott beteiligt waren, sie verborgen zu halten, sind zu verhaften.«
»Zu Befehl, Reichsführer.«
Himmler gab Dobrischowsky einen Wink, das Kabel betreffend. »Das genügt jetzt. Alles Weitere geht seinen Gang, auch ohne uns.«
Während Dobrischowsky sein Telephon wieder absteckte, ging Himmler unruhig auf und ab, offensichtlich noch ganz unter dem Eindruck dessen, was sie alle gerade miterlebt hatten. Keiner sagte ein Wort. Zweifellos war es nicht ratsam, die Gedankengänge des Reichsführers zu unterbrechen.
»Dass unser Vaterland«, begann Himmler schließlich, »jenen unglückseligen Krieg 14-17 am Ende so schmählich verloren hat, lag, wie wir heute wissen, nicht daran, dass die deutschen Soldaten versagt hätten, denn das haben sie nicht. Nein, der Krieg ging verloren, weil man der Wehrmacht in den Rücken gefallen ist – verräterische Elemente in der Heimat, angestachelt und geleitet vom Weltjudentum. Das deutsche Volk wäre von seiner Substanz her unbesiegbar gewesen, hätte es nicht den Fehler gemacht, allzu lange Zeit Schädlinge unter sich zu dulden, die ihm heimtückisch alle Kraft und alle Moral aussaugen: die Juden. Die Juden wissen genau, dass es eine natürliche Feindschaft zwischen ihnen und dem arischen Volk gibt, eine Feindschaft, die unweigerlich ausgetragen werden muss, in einem Kampf, den nur eines der beiden Völker überleben kann. Dieser Kampf, meine Herren, findet jetzt statt, in diesem Moment! Und der Arier darf ihn nicht verlieren, denn das wäre gleichbedeutend mit dem Verderben für die gesamte Menschheit, deren Kulturträger er ist.«
Er blieb vor dem Tisch stehen, auf dem sein Telephon lag, nahm es auf. »Wir sind im Osten in einer gefährlichen Situation, das wissen Sie. Unser Schicksal steht auf Messers Schneide. Doch es wäre ein Fehler, zu glauben, es würde sich nur durch die Zahl der Panzerdivisionen entscheiden, die uns zur Verfügung stehen. Das ist nur die äußerliche Seite unseres Kampfes. Dieser Krieg hat aber auch eine Front im Inneren, die genauso wichtig, genauso entscheidend ist wie die Front im Osten, und diese Front gilt unserer Befreiung von den Juden. Es muss uns gelingen, das deutsche Volk vollständig und restlos von den Juden und ihrem verderblichen, zersetzenden, blutsaugerischen Einfluss zu befreien. Nur wenn dies gelingt, werden wir am Ende auch siegen.«
Er steckte das Telephon ein, sah sie der Reihe nach an. »Ich gestehe, dass ich mit Vorbehalten hierher gekommen bin«, sagte er. »Ich habe erwartet, ein unnützes Überbleibsel jener elenden Republik vorzufinden, die den endgültigen Untergang des deutschen Volkes herbeigeführt hätte, wäre nicht der Führer im entscheidenden Moment auf den Plan getreten. Doch, meine Herren, es ist Ihnen gelungen, mich zu überzeugen. Ich sehe nun, dass auch Sie hier an einer Front kämpfen, die der auf dem Felde an Bedeutung nicht nachsteht. Ja, mir scheint, die Grausamkeit und Schärfe der Daten übertrifft die des Stahls noch bei Weitem. Was ich heute hier bei Ihnen gesehen habe, gibt mir die Gewissheit, dass von nun an niemand mehr vor uns sicher sein wird, niemand und nirgends. Meine Herren, Sie tragen dazu bei, dass wir ein Reich errichten, in dem abweichende, schädliche Denkweisen einfach nicht mehr existieren. Unsere Macht wird absolut sein in einem nie zuvor gekannten Sinne.«
Die anderen wirkten schwer beeindruckt. Lettke hingegen betrachtete Himmler und fragte sich, was er sich schon gefragt hatte, als er dessen Gesicht zum ersten Mal im Fernsehen gesehen hatte, nämlich woher dieser bebrillte Gnom eigentlich die Dreistigkeit nahm, für das arische Volk zu sprechen. Wer in der Führung – abgesehen vielleicht von Heydrich, dem Chef des Reichssicherheits-Hauptamts – war denn ein Arier? Nicht einmal Hitler selbst.
Das war im Grunde alles völlig lächerlich.
Aber sie waren nun mal an der Macht, und man musste sehen, wie man zurechtkam.
Erstaunlich eigentlich, dass ein so kluger Kopf wie Adamek das Ganze nicht einmal zu hinterfragen schien. Stattdessen saß er da in seinem rostigen Rollstuhl und versprach dem Reichsführer, unverzüglich ein Dossier über alle weiteren verdächtigen Personen in Amsterdam zu erstellen und ihm per Elektropost zukommen zu lassen. »Oder ausgedruckt«, fügte er hinzu. »Wie Sie es wünschen.«
Himmler winkte ab. »Klären Sie das mit dem Deportationskommando«, meinte er. »Viel wichtiger ist, dass Sie unverzüglich daran gehen, dieselbe Suche für alle deutschen Städte durchzuführen. Gerade jetzt, da das Schicksal des deutschen Volkes auf Messers Schneide steht, ist es von entscheidender Bedeutung, uns restlos vom Gift der jüdischen Zersetzung zu befreien.«
»Selbstverständlich, Reichsführer«, sagte Adamek.
Lettke ließ sich in einen Stuhl sinken, auf einmal von abgrundtiefer Erschöpfung erfüllt. Davongekommen. Er war einmal mehr davongekommen.
***
Sie geleiteten den Reichsführer und seine Entourage wieder zu den Autos, alle bis auf Adamek, und sahen den schwarzen Wagen nach, wie sie gelassen wieder von dannen rollten. Kaum waren sie verschwunden, entlud sich die Anspannung, die sie erfüllt hatte, in Gelächter und Schulterklopfen. Sie hatten es geschafft, geschafft, geschafft! Ihr Plan hatte funktioniert! Das NSA würde bleiben, was es war!
Auch Helene bekam Lob ab: Wie gut sie das gemacht hatte, und alles so schnell und prompt und ohne einen einzigen Fehler! Sogar die Völkers rang sich zu so etwas wie einem Wort der Anerkennung durch, doch auch das hörte Helene kaum. Sie nickte nur, spürte, wie ihr Gesicht das Lächeln produzierte, das alle zu sehen erwarteten, relativierte das Lob, wie es sich gehörte, denn: Hatten sie nicht alle Anteil daran?
All das tat sie ganz automatisch, musste gar nicht nachdenken, ihre gute Erziehung ließ sie genau wissen, was zu sagen und was zu tun war. Anders wäre es nicht gegangen, nicht, wenn sie hätte darüber nachdenken müssen, denn alles, was sie denken konnte, war, dass sie gerade dazu beigetragen hatte, den Mann, den sie liebte wie nichts auf der Welt, dem sicheren Tod zu überantworten.
|